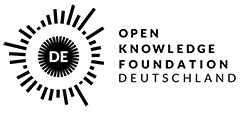Daten
Kommune
Jülich
Größe
375 kB
Datum
06.02.2014
Erstellt
30.01.14, 09:29
Aktualisiert
30.01.14, 09:29
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 2
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW
Stellungnahme
der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen
zum
Ersten Gesetz zur Umsetzung der VNBehindertenrechtskonvention in den Schulen
(9. Schulrechtsänderungsgesetz)
(Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 16/2432)
und zur
Änderung der Verordnung über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke
– Ausführliche Fassung –
Städtetag NRW
Gereonstraße 18 - 32
50670 Köln
Tel. 0221 / 3771-0
www.staedtetag-nrw.de
Landkreistag Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 8
40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 300491-0
www.landkreistag-nrw.de
Städte- und Gemeindebund NRW
Kaiserswerther Str. 199/201
40474 Düsseldorf
Tel. 0211 / 4587-1
www.kommunen-in-nrw.de
2
Gliederung
A. Vorbemerkung: Kommunen begrüßen Inklusion
B. Umsetzungsverpflichtung des Landes seit dem 26.03.2009
C. Zum Entwurf für ein Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen
I. Konnexitätsrelevanz des Entwurfs eines 9. Schulrechtsänderungsgesetzes
1. Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach
2. Konnexitätsrelevanz der Höhe nach
3. Vorleistungen der Kommunen
4. Zur Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände im vorparlamentarischen Verfahren im Hinblick auf die Konnexitätsfrage
5. Folgen einer fehlenden Ausgleichsregelung für die kommunalen Mehrbelastungen
II. Nicht hinreichende Umsetzung der VN-BRK
III. Kommunale Gestaltungsfreiheit und gleichwertige Lebensverhältnisse gewährleisten – dem Gesetzesvorbehalt genügen!
IV. Die Neuregelung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens
V. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen
1. Art. 1 – Änderungen des Schulgesetzes
2. Art. 2 – Übergangsvorschriften
3. Art. 4 – Inkrafttreten, Berichtspflicht
D. Zum Entwurf für eine Rechtsverordnung über die Größe der Förderschulen und
der Schulen für Kranke
I. Regelung muss im Schulgesetz erfolgen
II. Gewährleistung von Flexibilität für die Schulentwicklungsplanung
III. Sinnvolle Übergangsregelungen
E. Abschließendes Fazit
3
A. Vorbemerkung: Kommunen begrüßen Inklusion
Die nordrhein-westfälischen Kommunen begrüßen und unterstützen die Umsetzung der
Inklusion. Sie setzen sich aber für eine qualitätsorientierte und gehaltvolle Inklusion ein.
Kinder und Jugendliche dürfen im Rahmen von inklusivem Lernen nicht schlechter gefördert werden als bislang in den Förderschulen.
Der Entwurf eines 9. Schulrechtsänderungsgesetzes enthält keine hinreichende Umsetzung
des Art. 24 der VN-BRK. Er legt die Verantwortung für das Gelingen der schulischen Inklusion in die Hände der kommunalen Schulträger und der Lehrkräfte, ohne diese entsprechend zu unterstützen. Er vernachlässigt Qualitäts- und Ressourcenfragen. Da die Kommunen die finanziellen Herausforderungen alleine nicht bewältigen können, droht die Inklusion im Falle der Umsetzung des vorliegenden Entwurfs und der Verneinung der Konnexitätsrelevanz seitens des Landes in vielen Bereichen zu scheitern. Die Qualität der inklusiven Beschulung der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen wird von sehr heterogenen finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Kommune abhängen. Dies würde weder
dem verfassungsrechtlich gebotenen Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen,
noch der Bedeutung des gemeinsamen menschenrechtlich fundierten Anliegens gerecht.
B. Umsetzungsverpflichtung des Landes seit dem 26.03.2009
Wir begrüßen, dass der nordrhein-westfälische Landtag vier Jahre nach der Verbindlichkeit
der VN-BRK (diese wurde am 26.03.2009 für die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindlich) im April 2013 endlich den Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Umsetzung
der VN-BRK in erster Lesung beraten hat.
Obwohl das Land Nordrhein-Westfalen nach völkerrechtlicher Verbindlichkeit der VN-BRK
und wiederholter Aufforderungen durch die kommunalen Spitzenverbände vier Jahre gesetzgeberisch nicht aktiv geworden ist, hat die Landesregierung gleichwohl auf untergesetzlichem Weg vor Ort versucht, die Inklusion umzusetzen: Durch die Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke durch Runderlass des MSW vom 15.12.2010 (Amtsblatt NRW 01/11, S. 43) hat sie für die Ablehnung des Elternwunsches nach gemeinsamem
Lernen eine „Beweislastumkehr“ zugunsten der Eltern (bei Nichterfüllung des Elternwunsches ist eine dezidierte schriftliche Darlegung der Gründe erforderlich) vorgenommen.
Ferner hat sie die Schulaufsicht zu einer entsprechenden inklusionsfördernden Haltung
verpflichtet. U.a. durch diese Mechanismen und durch die mit der VN-BRK geweckten Erwartungshaltungen der Eltern und Kinder/Jugendliche ist es vor Ort bereits zu einer häufig
unkoordinierten, jedenfalls nicht auf der erforderlichen Gesetzesänderung beruhenden,
teilweise vor Ort auch für Unruhe sorgenden Inklusion gekommen, für welche dementsprechend oft nicht die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden konnten.
Aufgrund der fehlenden landesgesetzlichen Weichenstellungen war es vielen Kommunen
bisher nicht möglich, bei der Schulentwicklungsplanung die Inklusion adäquat zu berück-
4
sichtigen, da die angekündigten gesetzgeberischen Eckpunkte durch das Land lange auf
sich warten ließen.
C. Zum Entwurf für ein Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen
I. Konnexitätsrelevanz des Entwurfs eines 9. Schulrechtsänderungsgesetzes
1. Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach
Der Gesetzentwurf schreibt keine bereits in der Vergangenheit von den Schulen so wahrgenommene Aufgabe fort. Vielmehr erhält er einen Paradigmenwechsel weg von einer bisher und als Ausnahme - nicht als Regelfall praktizierten „Integration“ behinderter Schüler/innen hin zu einer als Regelfall zu handhabenden „Inklusion“. Auf diesen „Paradigmenwechsel“ hat auch die Schulministerin in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen.
Das bedeutet, dass das 9. Schulrechtsänderungsgesetz zu einer nach Art. 78 Abs. 3 LV
konnexitätsrelevanten Übertragung einer neuen Aufgabe bzw. einer wesentlichen Änderung einer bereits bestehenden Aufgabe und in der Folge zu einer wesentlichen, vom Land
finanziell auszugleichenden Mehrbelastung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes (i.F. KonnexAG) führt. Daher hätte dem Gesetzentwurf oder dem Entwurf eines zusätzlichen Belastungsausgleichsgesetzes eine entsprechende Kostenfolgeabschätzung beigefügt werden müssen (§ 6 Abs. 2 Konnex AG). Folglich rügen wir – wie bereits in der Vergangenheit gegenüber dem Referentenentwurf, auch
im Rahmen dieser Stellungnahme – den vorliegenden Verstoß gegen Art. 78 Abs. 3 der LV
und die Regelungen des KonnexAG. Diese Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach hat der
Leiter des Instituts für Staatswissenschaften der Universität Köln, Herr Prof. Wolfram Höfling, in seinem Rechtsgutachten „Rechtsfragen zur Umsetzung der Inklusion im Schulbereich“ von März 2012 bestätigt und im Einzelnen begründet1. Dieses Gutachten haben wir
sowohl der Landesregierung wie auch den Landtagsfraktionen seinerzeit zur Verfügung
gestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir an dieser Stelle auf die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW zum Referentenentwurf eines 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 24.10.2012 (Anlage 3).
2. Konnexitätsrelevanz der Höhe nach
Das Land hat in der Vergangenheit nicht nur die Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach
bestritten, sondern auch vorgebracht, dass den Kommunen keine erheblichen Kosten bei
der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich entstünden. Ferner hat es sich darauf berufen, dass ihm eine im Rahmen der Kostenfolgeabschätzung obliegende Prognose der zukünftigen Be- und Entlastungen nicht möglich sei.
1
Veröffentlicht unter: http://www.staedtetag-nrw.de/stnrw/inter/fachinformationen/bildung/065518/index.html
5
Obwohl es nicht die Aufgabe der Kommunen ist, bei einem konnexitätsrelevanten Gesetz
die verfassungsrechtlich dem Land obliegende Aufgabe zur Erstellung einer Kostenfolgeabschätzung zu übernehmen (Art. 78 Abs. 3 Satz 2 LV; § 6 Abs. 1 KonnexAG), haben die
kommunalen Spitzenverbände ein Konsortium von Bildungs- und Finanzwissenschaftlern
(Professor Dr. Horst Weishaupt, ehemaliger Leiter der Arbeitseinheit „Steuerung und Finanzierung des Bildungswesens“ des Deutschen Instituts für internationale pädagogische
Forschung, Frankfurt, sowie Professor Dr. Kerstin Schneider, Leiterin des Arbeitsbereichs
„Finanzierung des Bildungswesens“, Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Steuerlehre –
Schumpeter School of Business and Economics – Bergische Universität Wuppertal) mit der
Erstellung eines Gutachten beauftragt. Am Beispiel der Stadt Essen sowie des Kreises Borken samt seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird berechnet, welche finanziellen Be- und Entlastungen auf diese Kommunen zukämen, wenn das 9. Schulrechtsänderungsgesetz und die geplante Verordnung über die Schulgrößen der Förderschulen (Fassung vom September 2012) in der vorgelegten Form umgesetzt werden. Maßgeblich sind
insoweit die Erwartungen der Landesregierung, wonach von einer Inklusionsquote von
70% bei Lern- und Entwicklungsstörungen und von 50% bei den übrigen Förderschwerpunkten im Jahr 2017 auszugehen ist (vgl. „D“ im Vorspann des Gesetzentwurfes, 2. Absatz auf Seite 3 der Drs. 16/2432). Die Arbeiten an dem Gutachten sind noch nicht abgeschlossen. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und des Gutachterkonsortiums
(Dr. Alexandra Schwarz, Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Steuerlehre – Schumpeter
School of Business and Economics – Bergische Universität Wuppertal) werden aber in der
mündlichen Anhörung am 06.06.2013 erste Erkenntnisse aus der Begutachtung vortragen.
Indes hegen die kommunalen Spitzenverbände keinen Zweifel, dass die für die Geltendmachung von Konnexitätsansprüchen wesentliche Grenze von ca. 4,5 Millionen Euro landesweit ohne Weiteres in Folge der vorgesehenen Gesetzgebung überschritten werden
wird: Allein der Einbau eines Fahrstuhls, der auch im Brandfalle nutzbar bleibt, in ein Gebäude verursacht durchschnittliche Kosten in Höhe von 250.000 Euro, so dass nur durch
den Einbau von 18 Fahrstühlen landesweit diese Grenze überschritten wäre. Der nachträgliche Einbau einer Rampe verursacht durchschnittlich Kosten von 20.000 Euro, die Ausstattung eines Raumes DIN-gerecht als behindertengerechtes WC durchschnittlich Kosten von
10.000 Euro (vorausgesetzt, es besteht eine entsprechende Ausbaukapazität). Ein Quadratmeter zusätzlicher Schulraum dürfte (ohne die Berücksichtigung von Nebenkosten etwa
für den Brandschutz) Kosten von ca. 2.500. Euro verursachen. Das bedeutet, dass nur die
Erstellung eines für die Inklusion erforderlichen Differenzierungsraumes von 35 m2 ca.
86.000 Euro kosten würde. Vorausgesetzt bei einer zweizügigen Grundschule teilten sich
immer zwei Klassen einen Differenzierungsraum, entstünden zusätzliche Raumkosten in
Höhe von knapp 350.000 Euro. Hierbei sind notwendig anfallende Betriebskosten noch
nicht berücksichtigt. Die Schuljahreskosten für einen Integrationshelfer, der als Fachkraft
ausgebildet wurde, dürften (ausgehend von 190 Schultagen und 6 Stunden täglich) bei ca.
28.000 Euro, bei einer nur angelernten Kraft bei ca. 18.000 Euro liegen.
Auch die Landesregierung geht offenbar davon aus, dass im Zuge der Inklusion erhebliche
Sachkosten auf die Schulträger zukommen. So wurden in den Landeshaushalt 2013 im
Etat des Schulministeriums (Kapitel 05 450) „Investitionskosten bei den staatlichen Schu-
6
len im Zusammenhang mit der Inklusion“ von 100.000 Euro eingeplant. Ausweislich der
schriftlichen Beantwortung der Frage 3 der FDP-Fraktion aus Anlass der Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 16.01.2013 (zum Gesetz über die Feststellung
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013) durch die
stellv. Ministerpräsidentin und Schulministerin Löhrmann mit Schreiben vom 24.01.2013
(= Landtagsvorlage 16/578, S. 3) wurden „im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 100.000 EUR
vorgesehen, sofern an den staatlichen Schulen Investitionsausgaben für Hilfsmittel o.ä.
erforderlich sind, um den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten
Schülern zu ermöglichen.“ Die Mittel sind, wie weiter erläutert wird, zweckgebunden und
können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium verwendet werden, sofern an den
staatlichen Schulen ein tatsächlicher Investitionsbedarf im Zuge des Inklusionsprozesses
entsteht. Aus den Erläuterungen zu Kapitel 05 450 des Haushaltsplans 2013 geht hervor,
dass das Land Schulträgeraufgaben bei insgesamt neun Einrichtungen wahrnimmt. Rechnet man diesen (sicherlich konservativ gerechneten) Investitionsbedarf auf alle öffentlichen Regelschulen in NRW (5157, ohne Schulen für Kranke und Förderschulen, vgl. amtl.
Schulstatistik, Statistik-TELEGRAMM 2012/13, S. 9) hoch, ergibt sich nach Lesart des Landes nur für das Jahr 2013 eine Summe von mehr als 57 Millionen Euro allein für „Investitionsausgaben für Hilfsmittel o.ä.“ (also mutmaßlich ohne zusätzliche Bedarfe in Bereichen
bauliche Veränderungen, therapeutisches und Unterstützungspersonal, Schülertransport
etc.; vgl. Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW
zum Referentenentwurf eines 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 24.10.2012 = Anlage 3).
3. Vorleistungen der Kommunen
Viele Kommunen haben bereits in der Vergangenheit zur Umsetzung der Inklusion im
Schulbereich planerische und finanzielle Vorleistungen erbracht. Aus folgenden Gründen:
Erstens hatte man das menschenrechtliche Anliegen der Inklusion als richtig und die in
ihm liegenden Chancen für die förderbedürftigen Menschen, aber auch für die gesamte
Kommune erkannt. Zweitens wollte man den Menschen, die vor Ort ihre Hoffnungen und
Sorgen artikulierten, nicht enttäuschen. Drittens wurde seitens des Landes, insbesondere
durch die Schulaufsicht entsprechender Druck ausgeübt.
So hat beispielsweise im Juni 2012 die Stadt Köln einen eigenen Inklusionsplan präsentiert. Auch die Stadt Bonn ist sehr weit vorangeschritten. Sie nahm im Schuljahr
2010/2011 mit einer „Inklusions“-Quote von 26,3 % den Spitzenplatz unter allen Kreisen
und kreisfreien Städten in NRW ein (Gutachten von Klemm/Preuß-Lausitz). Ferner hat die
Stadt Bonn ein kommunales Inklusionsbüro eingerichtet, das den Inklusionsprozess steuert und voranbringt, aber auch in Einzelfällen Schulen im Umsetzungsprozess berät. Die
Kommune hat damit im Rahmen einer freiwilligen Leistung die Aufgabe übernommen, den
Inklusionsprozess zu begleiten. Ferner hat die Stadt Bonn die Finanzierung umfangreicher
Fortbildungs- und Beratungsmöglichkeiten zum Thema der Inklusion vorgenommen – eine
Aufgabe, die sie im Dienst der Sache und trotz eindeutiger Zuständigkeit des Landes übernommen hat. Die derart in Vorleistung getretenen Kommunen haben dies in der sicheren
Erwartung getan, eine entsprechende Unterstützung durch das zur schulgesetzlichen Um-
7
setzung verpflichtete Land zu erfahren. Inklusion kann nur in der Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen gelingen, wie es auch das Land immer wieder
betont. Dabei ist es die verfassungsrechtliche Aufgabe des Landes, die Kommunen entsprechend finanziell zu unterstützen. Die durch den Entwurf des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und die Ablehnung der Konnexität dem Grunde nach durch das Land bekundete
Haltung wird dem bisherigen Engagement der Kommunen nicht gerecht und die weitere
Umsetzung der Inklusion vor Ort nachhaltig beeinträchtigen.
4. Zur Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände im vorparlamentarischen
Verfahren im Hinblick auf die Konnexitätsfrage
Das KonnexAG enthält in §§ 6ff. detaillierte Vorgaben, in welcher Weise die kommunalen
Spitzenverbände einzubinden sind und wie ein Kostenfolgeschätzung durchzuführen ist.
Diese Vorgaben hat die Landesregierung nicht beachtet. Die gegenteiligen Behauptungen
unter „F 3.“ im Vorspann des Gesetzentwurfes treffen nicht zu. Eine „Beteiligung der
kommunalen Spitzenverbände nach dem Konnexitätsausführungsgesetz“ hat nicht stattgefunden:
Zwar hat die Landesregierung nach Vorlage des Referentenentwurfs (ohne Anerkennung
der Konnexitätsrelevanz) die kommunalen Spitzenverbände zu Gesprächen „nach § 7 KonnexAG“ eingeladen. Da aber zu keinem Zeitpunkt eine Kostenfolgeabschätzung der Auswirkungen der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich vorgelegt wurde (wozu das Land
gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 3 KonnexAG verpflichtet ist), konnte es sich hierbei um kein Verfahren nach dem KonnexAG handeln. Diesen Verfahrensfehler haben die
kommunalen Spitzenverbände seinerzeit mehrfach und explizit schriftlich und mündlich
gerügt, sich aber den (formlosen) Rechtsgesprächen in dieser Sache nicht verschlossen.
Allerdings blieben auch diese letztendlich erfolgslos.
Die kommunalen Spitzenverbände haben die Landesregierung bereits im Vorfeld der Vorlage des Referentenentwurfs eines 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und danach immer
wieder auf die Konnexitätsrelevanz einer Umsetzung der Inklusion im Schulbereich hingewiesen und mit großer Klarheit auf die Notwendigkeit der Erstellung einer Kostenfolgeabschätzung durch das Land sowie des Vorsehens eines entsprechenden Belastungsausgleichs bestanden.
Sie haben dem Land auch wiederholt ihre Unterstützung bei der Erstellung einer Kostenfolgeabschätzung angeboten, obwohl die Erstellung der Kostenfolgeabschätzung nach der
Landesverfassung und dem KonnexAG, wie bereits ausgeführt, eine Verpflichtung des Landes ist. Diese Angebote hat das Land nicht angenommen. In diesem Zusammenhang ist
auch den Behauptungen unten im vierten Absatz „F 3.“ im Vorspann des Gesetzentwurfes
zu widersprechen. Das Land hätte – einen entsprechenden Willen vorausgesetzt – ggf. in
Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden die erforderlichen Daten beschaffen bzw. erheben können. Inwiefern dieses „nach geltendem Recht nicht statthaft“
sein könnte, ist in keiner Weise nachvollziehbar!
8
5. Folgen einer fehlenden Ausgleichsregelung für die kommunalen Mehrbelastungen
Im Falle eines Beschlusses auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfes des 9.
Schulrechtsänderungsgesetzes ist eine verfassungsgerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem Land und den Kommunen zu befürchten, da die Kommunen gezwungen sein
werden, zur Wahrung ihrer in Art. 78 Abs. 3 LV garantierten Rechtsposition den Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen – ähnlich wie im Falle des Kinderförderungsgesetzes – anzurufen. Die kommunalen Spitzenverbände bedauern sehr, dass es in
der Vergangenheit trotz vielfältiger Versuche nicht gelungen ist, die Landesregierung zur
Beachtung des Art. 78 Abs. 3 LV anzuhalten.
II. Nicht hinreichende Umsetzung der VN-BRK
Die Durchsicht des Entwurfes eines 9. Schuländerungsgesetzes zeigt, dass die Landesregierung Art. 24 der VN-BRK leider nur ansatzweise umsetzt und auch den Hinweisen der
kommunalen Spitzenverbänden sowie vieler anderer Beteiligter zum Referentenentwurf
nicht gefolgt ist. Viele wesentliche Fragen werden nicht entschieden, sondern den Kommunen zur Beantwortung überlassen. Zwar räumt Art. 24 der VN-BRK, der das „ob“ der Inklusion nicht in Frage stellt, den Ländern bei der Umsetzung Entscheidungsspielräume ein.
Dieses bedeutet aber im Sinne eines „Untermaßverbotes“ nicht, dass das Land alle wesentlichen Umsetzungsentscheidungen den kommunalen Schulträgern überantworten
könnte. Insoweit genügt das Land nicht seiner völkerrechtlichen Umsetzungsverpflichtung
zur Schaffung eines inklusiven Schulsystems.
Insoweit möchten wir auf die Eckpunkte der Monitoring-Stelle zur VN-BRK zur Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems (Primarstufe und Sekundarstufen I und II) hinweisen, die seitens des Deutschen Instituts für Menschenrechte den 16 Kultusministerien bereits im September 2010 zugeleitet wurden. Diese Eckpunkte werden von dem vorgelegten
Gesetzentwurf hinsichtlich der darin geforderten Sicherstellung der erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen sowie der Regelung der „angemessenen Vorkehrungen“ für eine
inklusive Beschulung im Sinne der VN-BRK nicht hinreichend beachtet.
III. Kommunale Gestaltungsfreiheit und gleichwertige Lebensverhältnisse gewährleisten – dem Gesetzesvorbehalt genügen!
Der vorliegende Gesetzentwurf räumt der kommunalen Ebene auf den ersten Blick beträchtliche (neue) Handlungsspielräume ein. Das wäre aus unserer Sicht grundsätzlich zu
begrüßen, wenn Handlungsfreiheit auch tatsächlich bestünde und nicht durch die Vorenthaltung der erforderlichen Ressourcen oder auf anderem Weg unmittelbar wieder eingeschränkt würde. Der Landesgesetzgeber hat aber auch gleichwertige Lebensverhältnisse zu
gewährleisten und dem Gesetzesvorbehalt zu genügen. In diesem Spannungsfeld gilt es
den richtigen Weg zu finden. Der vorliegende Entwurf für eine Schulgesetzänderung entspricht zusammen mit dem Entwurf einer Verordnung über die Schulgrößen (diese Verord-
9
nung müsste nach unserer Auffassung gemeinsam mit dem Gesetzentwurf im Landtag
beraten werden, vgl. unten D.) diesen Anforderungen bislang nicht.
Die im Gesetzentwurf enthaltenen „Öffnungsklauseln“, auf die im weiteren Verlauf der
Stellungnahme unter II. noch im Einzelnen eingegangen werden wird, bedeuten, dass die
kommunalen Schulträger im Wesentlichen entscheiden sollen, wo und wie schnell die Inklusion vor Ort umgesetzt werden wird, und dass das Land sich insoweit aus seiner Verantwortung zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse, namentlich auch Bildungschancen und vergleichbarer Bildungsabschlüsse, zurück zieht. Dies wird sehr wahrscheinlich zu einem Inklusionsprozess mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den jeweiligen Regionen führen. Bereits heute ist eine sehr heterogene Landschaft gemeinsamen
Lernens festzustellen (vgl. http://www.gis.nrw.de/inklusion ), die nicht nur auf eine unterschiedliche Haltung der handelnden Akteure in der Kommune und der Landesschulverwaltung, sondern auch auf die jeweilige kommunalhaushaltsrechtliche Lage mit ihren nicht zu
leugnenden Zwängen zurückzuführen ist. Dass sich diese Unterschiede verstärken, ist sehr
wahrscheinlich, wenn die vorliegenden Entwürfe unverändert umgesetzt werden. Es besteht die Gefahr, dass die Verwirklichung des menschenrechtlich fundierten Anspruchs auf
inklusive Beschulung standortabhängig werden wird.
Auch
wenn
die
kommunalen
Spitzenverbände
grundsätzlich
die
Einräumung
von
Gestaltungsspielräumen vor Ort begrüßen, so ist im vorliegenden Fall neben den völkerund verfassungsrechtlichen Bedenken aber doch sehr fraglich, wie groß diese vom Land
den Kommunen eingeräumten Gestaltungsmöglichkeiten wirklich sind und was die tatsächliche Motivation für ein derartiges Vorgehen der Landesregierung ist.
Wegen der bereits erwähnten „Beweislastumkehr“ durch die Ende 2010 vorgenommene
Änderung der VV-AOSF durch die Landesregierung, der veränderten Haltung und Praxis
der Schulaufsicht (Wirken sog. „Koordinatorinnen und Koordinatoren für Inklusion“) sowie
den bei den Eltern geweckten Erwartungshaltungen dürften de facto kaum noch Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Auch hängen die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten
neben den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln auch von der Ausübung der Wahlfreiheit der Eltern ab. Diese durch den Gesetzentwurf eingeräumte „Wahlfreiheit“ mit der Konsequenz des kurzfristigen Aufrechterhaltens gewisser Parallelsysteme von allgemeinen
Schulen und Förderschulen wird dazu führen, dass Förderschulen (zumindest in den Bereichen Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache) immer weniger nachgefragt werden und damit unter die Mindestschülerzahl „rutschen“ und geschlossen werden
müssen. Dies wird durch die gleichzeitig angestrebte Veränderung der Verordnung über
die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke, welche durch den vorgesehenen Auflösungsautomatismus (vgl. unten) in den nächsten Jahren zu erheblichen
Schließungen von Förderschulen führen wird, noch verstärkt werden.
Die mangelnden Festlegungen und Entscheidungen der Landesregierung zur Umsetzung
der Inklusion im Schulbereich lassen leider den Schluss zu, dass diese vage Umsetzung
des Art. 24 VN-BRK durch das Ziel motiviert ist, den Konsequenzen des verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips mit einer etwaigen Belastung des Landeshaushaltes auszuwei-
10
chen. Dieses führt aber zu einer Verletzung der völkerrechtlichen Umsetzungsverpflichtung
sowie innerstaatlich zu einer Verletzung des Gesetzesvorbehaltes. Dieser besagt, dass die
wesentlichen grundrechtsrelevanten Entscheidungen durch den Gesetzgeber getroffen
werden müssen und nicht der Verwaltung überlassen werden dürfen. Unser demokratischer Rechtsstaat verlangt, dass Verantwortlichkeiten nicht nur klar erkennbar sind, sondern Verantwortung auch übernommen wird.
Damit sowohl die Inklusion als auch die kommunale Handlungsfreiheit funktionieren kann,
muss das Land klar und ehrlich die kommunalen Gestaltungsspielräume definieren und die
notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen.
IV. Die Neuregelung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens
Von besonderer Tragweite ist die geplante Beschneidung des Rechts der Schule zur Einleitung des Verfahrens auf Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig grundsätzlich nur noch die Eltern das Verfahren in Gang setzen können. Ein Antragsrecht der Schule bezüglich des Förderschwerpunktes Lernen soll zunächst gar nicht, sondern erst nach Vollendung des 3. Schuljahres bis zur
Vollendung des 6. Schuljahres bestehen. Bezüglich des Förderschwerpunktes Emotionale
und soziale Entwicklung soll ein Antragsrecht der Schule nur bestehen, wenn eine Selbstoder Fremdgefährdungstendenz bei der Schülerin oder dem Schüler vorliegt. Eine Selbstoder Fremdgefährdung ist aber nicht gleichzusetzen mit erheblichen Beeinträchtigungen
des Unterrichts. In allen anderen Fällen kann ein Antrag nur unter den engen Voraussetzungen des § 19 Abs. 7 Nr. 1 des Gesetzentwurfs gestellt werden.
Wenn man zusätzlich den Umstand berücksichtigt, dass in der Vergangenheit nur etwa 5
% der Feststellungsverfahren von den Eltern eingeleitet wurden, dann liegt die Erwartung
nahe, dass künftig bei einer wesentlichen Anzahl von Schüler/innen der sonderpädagogische Förderbedarf – vor allem in den Bereichen Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung – erst gar nicht festgestellt werden wird, obwohl sich die tatsächlichen Verhältnisse und Unterstützungsbedarfe durch diesen schwerwiegenden Wandel des Feststellungsverfahrens nicht ansatzweise verändern. Im Ergebnis wird diese Regelung unmittelbar dazu führen, dass die nach wie vor unterstützungsbedürftigen Schüler/innen als solche
nicht mehr statistisch erfasst werden und dann auch an der „Doppelzählung“ bezüglich der
Lehrerstellenzuweisung nicht teilnehmen werden.
Ferner lässt der Gesetzentwurf nicht erkennen, wie die nach wie vor vorliegenden Unterstützungsbedarfe bei den betroffenen Schüler/innen erkannt/diagnostiziert werden sollen.
Zwar fordern Vertreter der Inklusionspädagogik ein Schulsystem, das weitgehend ohne
Klassifikationsdiagnose auskommt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass mit Klassifikationsdiagnosen Stigmatisierungen geschaffen werden, die das Leben der betroffenen Kinder lebenslang ungünstig beeinflussen. Hinzu kommt das beim Deutschen Förderschulsystem bislang bestehende so genannte „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“. Wenn man
aber Klassifikationsdiagnostik aus diesen Gründen abbaut, muss man gleichzeitig eine systematische Lernfortschrittsdiagnostik in der Schule etablieren. Zurzeit ist nicht erkennbar,
11
inwieweit seitens des Landes sichergestellt werden kann, dass die jetzt schon mit Wirkung
ab 2013 geplante Neuregelung des Verfahrens durch entsprechende schulische Diagnostiken und Messinstrumente aufgefangen werden könnte bzw. inwieweit bis zu diesem Zeitpunkt die im System befindlichen und für die Diagnostik nicht ausgebildeten Lehrerinnen
und Lehrer eingesetzt werden sollten. Diese Ungleichzeitigkeit wird dazu führen, dass die
nach wie vor unterstützungsbedürftigen Schüler/innen sowie die in dieser Hinsicht nicht
hinreichend aus- und fortgebildeten Lehrerinnen und Lehrer die notwendige Unterstützung
nicht erhalten. Auch wird aus dem Gesetzentwurf nicht deutlich, inwieweit die seitens der
Landesregierung zitierten „multiprofessionellen Teams“ in Zukunft gewährleistet werden
sollen. Gerade im Zusammenhang mit der erforderlichen Lerndiagnostik müsste die hierfür
wesentliche Aufgabe der Schulpsychologie, aber auch die Schulsozialarbeit mitgedacht
werden.
V. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen
1. Art. 1 – Änderungen des Schulgesetzes
§ 2 Abs. 5
Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung. In der Schule werden sie in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). Schüler/innen, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen
sind, werden nach ihrem individuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe
und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen.
Die Erweiterung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages um das Ziel der inklusiven Bildung und Erziehung wird ausdrücklich begrüßt. Aus der Begründung der Landesregierung geht hervor, dass der hiermit verbundene Paradigmenwechsel im Sinne einer
wesensmäßigen Veränderung des Systems Schule erkannt wurde: „Der Begriffswandel von
der Integration zur Inklusion bedeutet, dass es nicht mehr darum gehen kann, Menschen
zur Teilhabe an einem Regelsystem zu befähigen, sondern dieses Regelsystem so einzurichten, dass es gleichermaßen den Bedürfnissen aller Menschen – auch denen mit Behinderungen – gerecht wird“ (Begründung des Gesetzentwurfes zu Art. 1 Nr. 1 (§ 2), zu Abs.
5, Sätze 1 und 2 auf S. 44 der Drs. 16/2432). Dabei beschränkt sich dieser Paradigmenwechsel nicht allein auf eine inklusionsförderliche Haltung, sondern entsprechend der VNBRK auch auf die entsprechende personelle und sächliche Begleitung.
12
§ 19 Abs. 5
Auf Antrag der Eltern entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und die Förderschwerpunkte. Vorher holt sie ein sonderpädagogisches Gutachten sowie, sofern erforderlich, ein medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ein und beteiligt die Eltern. Besteht ein Bedarf, schlägt sie den
Eltern mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vor, an der
ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist. (…)
Abs. 7
In Ausnahmefällen kann eine allgemeine Schule den Antrag nach Abs. 5 stellen, insbesondere
1. wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht zielgleich unterrichtet werden kann oder
2. bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, der mit einer Selbst- oder Fremdgefährdung einhergeht.
Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen kann die allgemeine Schule den Antrag in der Regel erst stellen, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase der Grundschule im dritten Jahr besucht; nach dem Ende der Klasse 6 ist ein Antrag nicht mehr möglich.
Dies ist eine massive Änderung gegenüber der bisherigen Gesetzeslage, wonach grundsätzlich neben den Eltern auch die Schule das Verfahren einleiten konnte. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Antragsrecht der Schule bezüglich des Förderschwerpunktes Lernen in der Regel erst im dritten Jahr des Besuchs der Schuleingangsphase der Grundschule
bis zur Vollendung des 6. Schuljahres bestehen soll. Bezüglich des Förderschwerpunktes
„Emotionale und soziale Entwicklung“ soll ein Antragsrecht der Schule nur bestehen, wenn
eine Selbst- oder Fremdgefährdungstendenz bei der Schülerin oder dem Schüler vorliegt.
Selbst- oder Fremdgefährdung ist aber nicht gleichzusetzen mit erheblichen Beeinträchtigungen des Unterrichts – es stellt erkennbar eine wesentlich höhere Hürde auf. In allen
anderen Fällen kann ein Antrag nur unter den engen Voraussetzungen des § 19 Abs. 7 Nr.
1 des Gesetzesentwurfes gestellt werden. Wenn man dieser Stelle zusätzlich den Umstand
berücksichtigt, dass in der Vergangenheit nur etwa 5 Prozent der Feststellungsverfahren
von den Eltern eingeleitet wurden, dann liegt die Erwartung nahe, dass künftig bei einer
wesentlichen Anzahl von Schüler/innen der sonderpädagogische Förderbedarf – vor allem
in den Bereichen Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung – erst gar nicht festgestellt wird, obwohl sich die tatsächlichen Verhältnisse und Unterstützungsbedarfe durch
diesen schwerwiegenden Wandel des Feststellungsverfahrens nicht verändern. Im Ergebnis
wird diese Regelung unmittelbar dazu führen, dass die nach wie vor unterstützungsbedürftigen Schüler/innen als solche nicht mehr statistisch erfasst und dann auch an der „Doppelzählung“ bezüglich der Lehrerstellenzuweisung nicht teilnehmen werden. Mittelbar besteht die Gefahr, dass unterstützungsbedürftige Schüler/innen die notwendige Unterstützung nicht erhalten werden und dieser Mangel an Unterstützung – wenn überhaupt möglich – über kommunales Personal (Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter etc.) aufgefangen
werden muss. Es wird bezweifelt, dass in der Schule bei den beteiligten Lehrern der allgemeinen Schule eine hinreichende Diagnose- und Fachkompetenz bereits flächendeckend
vorliegt, sodass sie eine entsprechende pädagogische Entscheidung treffen können. In
vielen Fällen werden deshalb entsprechende Bedarfe der Kinder nicht mehr rechtzeitig er-
13
kannt und bedient werden. Im Sinne der betroffenen Kinder ist es, wenn ein sonderpädagogische Förder- bzw. Unterstützungsbedarf möglichst frühzeitig geklärt wird. Die Schulen
müssen daher weiterhin in geeigneter Weise die Möglichkeit haben, die Feststellung sonderpädagogischen Förder- bzw. Unterstützungsbedarfs einzuleiten.
Bei Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung soll die Schulaufsichtsbehörde den Eltern mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule vorschlagen, an
der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist. Es stellt sich die Frage, wie
verfahren werden soll, wenn der Schulträger seine Zustimmung nicht erteilen kann, da die
in Betracht kommenden Schulen dafür personell und sächlich nicht ausgestattet sind und
auch nicht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden können. Hier bedarf es
einer deutlich praxisnäheren und verbindlicheren Regelung, da insbesondere zu bezweifeln
ist, dass es, wie die Gesetzesbegründung annimmt (vgl. S. 48), zu pauschalen Zustimmungen kommt. Denkbare wäre z.B. eine Ergänzung von § 19 Abs. 5 Satz 4, dass auch §
20 Abs. 2 Satz 2 unberührt bleibt; wenn die Förderschule gewählt wird, besteht keine
Notwendigkeit, eine allgemeine Schule vorzuschlagen. Auch für den Fall eines späteren
Wechsels des Förderorts bedarf es praktisch handhabbarer Umsetzungsvorschriften.
§ 19 Abs. 8
Das Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des für Schulen
zuständigen Landtagsausschusses die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung sowie zur Festlegung der Förderschwerpunkte und Benennung geeigneter Schulen einschließlich der Beteiligung der
Eltern und die Vergabe der Abschlüsse nach Maßgabe des Absatzes 4.
Es erscheint fraglich, ob die wesentlichen Grundzüge des Verfahrens nicht, um dem Vorbehalt des Gesetzes zu genügen (vgl. schon die Ausführungen oben), durch den Parlamentsgesetzgeber zu regeln sind (s. Bericht des MSW über die Evaluierung des Schulgesetzes vom 15.12.2011).
§ 20 Abs. 2
Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule statt. Die
Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wählen.
In Verbindung mit § 20 Abs. 1 wird entsprechend dem Beschluss des Landtags vom
1.12.2010 mit dem Elternwahlrecht das Parallelsystem festgeschrieben. Es steht indes zu
befürchten, dass das so formulierte „Elternwahlrecht“ in kurzer Zeit nicht mehr gewährleistet werden kann. Durch den gleichzeitig vorgelegten Entwurf einer Verordnung zu den
Mindestgrößen von Förderschulen (der nicht vom Landtag beraten werden soll – siehe unten unter D.), der die Abschaffung der Ausnahmeregelung des bisherigen § 2 der 6. Verordnung zur Ausführung des Schulverwaltungsgesetzes enthält, wird das Wahlrecht der
Eltern in der Praxis ganz erheblich eingeschränkt werden. Viele Förderschulen, insbesondere mit dem Förderschwerpunkt Lernen, wird die vorgesehenen Mindestgrößen erfüllen.
14
Durch die Abschaffung der Ausnahmeregelung des bisherigen § 2 der 6. Verordnung zur
Ausführung des Schulverwaltungsgesetzes wird das Wahlrecht der Eltern in der Praxis erheblich eingeschränkt werden. Beispielsweise werden in der Stadt Hamm drei von vier
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen betroffen sein. Es wird zur Schließung
sehr vieler Förderschulen im ganzen Land kommen. (vgl. die geplante Regelung der Verordnung über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke). Dies wird
zu beträchtlicher Unruhe in der betroffenen Elternschaft und zu großen Konflikten vor Ort
führen. Die vermeintlich eingeräumte kommunale Handlungsfreiheit wird gerade an diesem Punkt in besonders augenfälliger Weise de facto durch eine untergesetzliche Landesnorm konterkariert. Die durch diese Vorschrift ausgelöste Notwendigkeit, Förderschulstandorte zusammenzulegen, verlängert vor allem im kreisangehörigen Bereich die Fahrtwege und löst damit unmittelbar beträchtliche Mehrkosten für die Schülerfahrtkostenträger
aus. Wir bitten daher, diese Regelung zu überdenken. Zumindest aber ist die Einräumung
entsprechend großzügiger Übergangsfristen zwingend erforderlich (ausführlicher zur Regelung der Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke unter D.)
§ 20 Abs. 4
In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde abweichend von der Wahl
der Eltern die allgemeine Schule anstelle der Förderschule oder die Förderschule anstelle
der allgemeinen Schule als Förderort bestimmen. Dies setzt voraus, dass die personellen
und sächlichen Voraussetzungen am gewählten Förderort nicht erfüllt sind und auch nicht
mit vertretbarem Aufwand erfüllt werden können. Die Schulaufsichtsbehörde legt die
Gründe dar und gibt den Eltern die Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung
zu äußern. Gleichzeitig informiert sie über weitere Beratungsangebote.
Hier besteht Klarstellungsbedarf hinsichtlich der Zuständigkeit der Schulaufsichtsbehörde.
Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit wird vorgeschlagen, auf den Wohnort der Schülerin/des Schülers abzustellen. Als sinnvoll wird angesehen, die Zuständigkeit für Schüler/innen der Primarstufe den staatlichen Schulämtern und für Schüler/innen ab der Sekundarstufe I einschließlich des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe I den
Bezirksregierungen zuzuordnen. Da die Bezirksregierung die Dienstaufsicht (damit auch
den Personaleinsatz) für die Hauptschulen wahrnimmt und nicht in allen Städten und Gemeinden alle Schulformen der Sekundarstufe I vorgehalten werden, ist es geboten, die
Organisation des Gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe I in eine Hand zu legen.
§ 20 Abs. 5
Die Schulaufsichtsbehörde richtet Gemeinsames Lernen mit Zustimmung des Schulträgers
an einer allgemeinen Schule ein, es sei denn, die Schule ist dafür personell und sächlich
nicht ausgestattet und kann auch nicht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden.
Mit einer qualitätsvollen Umsetzung der VN-BRK und der Sicherstellung des Menschenrechts auf Teilhabe für alle Schüler/innen ist der hier vorgesehene Ressourcenvorbehalt
dem Grunde nach nicht vereinbar. Der in § 20 Abs. 5 vorgesehene Ressourcenvorbehalt
darf nicht mit dem progressiven Realisierungsvorbehalt der VN-BRK, den diese ausdrücklich zulässt, verwechselt werden. Die Kommunen werden die notwendigen und umfänglichen Leistungen nur mit Hilfe eines Belastungsausgleichs des Landes erbringen können.
15
Ferner stellt sich die Frage nach der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs „vertretbarer Aufwand.“ Dieser kann nur in Abhängigkeit von örtlichen und damit auch HaushaltsVerhältnissen bestimmt werden. Dies dürfte – wie bereits ausgeführt – zu unterschiedlichen Ausstattungsentscheidungen führen, mit der Folge, dass die Ausübung des menschenrechtlich fundierten Anspruchs auf inklusives Lernen standortabhängig sein wird,
jedenfalls aber die Prämisse, dass eine Förderung nicht schlechter als im derzeitigen System sein darf, massiv in Frage gestellt. Gerade hier ist der Gesetzgeber verpflichtet, dem
Vorbehalt des Gesetzes dadurch zu genügen, dass er im Wesentlichen regelt, wann ein
Aufwand als noch vertretbar anzusehen ist. Schüler, Eltern, Kommunen dürfen nicht darauf verwiesen werden, dass diese essentiellen Fragen ggf. erst nach vielen Jahren durch
eine verwaltungsgerichtliche Kasuistik zufriedenstellend beantwortet werden können.
Schließlich sollte in § 20 Abs. 5 ermöglicht werden, dass mehrere Schulträger gemeinsam
Angebote Gemeinsamen Lernens einrichten können. Insbesondere sollte eine gebietsgrenzenübergreifenden Zusammenarbeit und eine Zusammenarbeit mit den Landschaftsverbänden als Trägern von Förderschulen ermöglicht werden. Insoweit ist unbedingt eine
Konkordanz mit den Regelungen über die Mindestgrößen von Förderschulen (vgl. dazu
unten C) herzustellen.
§ 20 Abs. 6
Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulangebot können Schulträger mit Zustimmung
der oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine Schulen als Schwerpunktschulen bestimmen. Eine solche Schule umfasst über die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie
Emotionale und soziale Entwicklung hinaus weitere Förderschwerpunkte, mindestens
aber einen weiteren Förderschwerpunkt. Die Schwerpunktschule unterstützt andere
Schulen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 4.
Die Einrichtung von Schwerpunktschulen (ob, welche, wie viele und wo?) wird in die Entscheidungsmacht der Schulträger gelegt. Während die Idee von Schwerpunktschulen als
Durchgangsstadium zu einer vollständigen Inklusion für den Bereich der größeren Schulträger unter pragmatischen Gesichtspunkten durchaus schlüssig erscheint, sind die Konsequenzen für ländlich strukturierte Gebiete nicht zu Ende gedacht.
Anders als bei einer großen Stadt sind hier in der Regel verschiedene Schul- und Kostenträger betroffen. Ein kleiner Schulträger im ländlichen Raum muss aber zwangsläufig damit
rechnen, dass er de facto die inklusive Beschulung für ein über seinen räumlichen Zuständigkeitsbereich hinausgehendes Umfeld mit übernehmen muss. Mit der Anerkennung des
Status einer Schwerpunktschule (und dem damit verbundenen Signal, für die Aufnahme
von Schülern mit Lernbehinderung, emotionalen und sozialen Störungen und mindestens
einer weiteren Behinderungsart gerüstet zu sein) wird die Schulaufsicht die betreffende
Schule stets bei den Empfehlungen für eine inklusionsgeeignete allgemeine Schule „berücksichtigen“. Dies gilt umso mehr, wenn sich wohnortnähere Alternativen nicht anbieten.
Wegen des Rechtsanspruchs der Eltern auf Nennung wenigstens einer allgemeinen Schule
wird der Aufsicht gar nichts anderes übrig bleiben, als die Schwerpunktschule bis zur Erschöpfung sämtlicher Kapazitätsgrenzen in Anspruch zu nehmen.
16
Für einen einzelnen Schulträger wird es aber kaum leistbar sein, die inklusive Beschulung
für das gesamte Umfeld auch von Nachbarkommunen zu übernehmen. Alleine der (bereits
heute ohne ausgebaute Inklusion konfliktträchtige) Bereich der Schülerfahrkosten wird
erhebliche, im Falle der Notwendigkeit von Einzeltransporten sogar exorbitante zusätzliche
Kosten für den Träger einer Schwerpunktschule nach sich ziehen. Insoweit ist der Gesetzentwurf zu wenig ausgereift und löst die sich unmittelbar im Kontext von Schwerpunktschulen stellenden Fragen nicht. Die vorgeschlagene Regelung bietet zusammen mit der
geltenden Schülerfahrtkostenverordnung keinen Anreiz, eine Schwerpunktschule einzurichten. Die kommunalen Spitzenverbände empfehlen dem Land dringend, im Hinblick auf die
Lösung der Probleme gemeinsame Überlegungen zu Verfahrens- und Kostenausgleichsregelungen anzustellen.
§ 37 Abs. 3
Kinder und Jugendliche mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung können, wenn
das Bildungsziel in anderer Weise nicht erreicht werden kann und Hilfen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches erforderlich sind, auf Vorschlag des Jugendamtes und
mit Zustimmung der Eltern durch die Schulaufsichtsbehörde auch in Einrichtungen der
Jugendhilfe untergebracht werden und dort ihre Schulpflicht erfüllen. Verweigern die Eltern ihre Zustimmung, so ist eine Entscheidung nach § 1666 des Bürgerlichen Gesetzesbuches herbeizuführen.
Es sollte bei der neuen Formulierung deutlich werden, welche Verpflichtungen die Schulaufsicht hat. Falls es intendiert ist, dass von Kindern, die in stationären Einrichtungen der
Jugendhilfe untergebracht sind, die Schulpflicht – nach entsprechender Genehmigung
durch die Schulaufsicht – in diesen Einrichtungen erfüllt wird, darf sich das Land in diesen
Fällen seiner schulrechtlichen Finanzverantwortung nicht entziehen.
§ 46 Abs. 4
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Einvernehmen mit dem Schulträger die
Zahl der in die Klasse 5 einer Schule der Sekundarstufe I oder mit Sekundarstufe I aufzunehmenden Schüler/innen begrenzen, wenn
1.
2.
3.
ein Angebot für Gemeinsames Lernen (§ 20 Abs. 2) eingerichtet wird,
rechnerisch pro Parallelklasse mindestens zwei Schüler/innen mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufgenommen werden und
im Durchschnitt aller Parallelklassen der jeweilige Klassenfrequenzrichtwert nach der
Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 SchulG nicht unterschritten wird.
Die Vorschriften zu den Klassengrößen der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2
SchulG bleiben unberührt.
Zunächst ist die Begrenzung der Vorschrift auf den Bereich der Sekundarstufe I unverständlich. Im Bereich der Primarstufe besteht dieselbe Problemlage.
Die Herabsetzung der Aufnahmekapazität gem. § 46 Abs. 4 sollte nicht als „Änderung einer Schule“ im Sinne von § 81 Abs. 2 SchulG gelten, die ein zeitaufwändiges Genehmigungsverfahren durch die Obere Schulaufsicht auslöst.
17
Zu beachten ist, dass die Möglichkeit, die Zahl der Schüler/innen zu begrenzen, nur dann
vorliegen wird, wenn rechnerisch pro Parallelklasse mindestens zwei Schüler/innen mit
festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufgenommen werden. Durch
die Neuregelung des Feststellungsverfahrens im Rahmen des § 19 Abs. 5 des Gesetzentwurfs wird es aber nur noch in den seltensten Fällen dazu kommen, dass Schüler/innen
festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben werden. Sie scheiden
somit sowohl für eine Doppelzählung bei der Lehrerzuweisung wie auch bei der Möglichkeit
der Herabsetzung der Aufnahmekapazität nach § 46 Abs. 4 aus.
Zu dem in der Begründung dargestellten Berechnungsbeispiel (vierzügige Gesamtschule)
ist anzumerken, dass bei der ermittelten Schülerzahl von 112 dann (mindestens) 8 Schüler/innen mit dem Unterstützungsbedarf, z. B. im Förderschwerpunkt Lernen, aufgenommen werden. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass die Aufnahmekapazität für Schüler/innen ohne Unterstützungsbedarf von 120 auf 104 sinkt.
Die vorgesehene Regelung in § 46 Abs. 4 Ziffer 3 führt zu einer Vergrößerung der Parallelklassen zugunsten der Klasse(n) mit Gemeinsamen Lernen, wie auch aus dem Beispiel in
der Gesetzesbegründung deutlich wird. Dieses dürfte von den Eltern der Kinder in den
großen Klassen als benachteiligend empfunden werden. Es widerspricht auch den Aussagen des Landes, die Inklusion unter Nutzung von „Demografiegewinnen“ mit besserer Lehrer-Schüler-Relation umzusetzen. Ziffer 3 sollte deshalb wie folgt lauten:
„3. Im Durchschnitt aller anderen Parallelklassen der jeweilige Klassenfrequenzrichtwert(…) nicht unterschritten wird.“
Eine reduzierte Größe einer Klasse mit gemeinsamem Lernen auch unterhalb des Klassenfrequenzrichtwertes dürfte durch diese Änderung die automatische Konsequenz sehr großer Parallelklassen vermeiden.
In Städten wie Köln, Bonn und Düsseldorf mit steigenden Schülerzahlen wird es regional
schwierig bis nicht möglich sein, an einzelnen Schulen die Klassengrößen entsprechend im
Durchschnitt zu reduzieren, ohne das zusätzlicher Schulraumbedarf entsteht. Zudem ist
eine Herabsenkung der Klassenstärke einer Klasse mit Gemeinsamem Lernen durch Kompensation mit den Klassengrößen anderer Klassen in derselben Schule deshalb nicht umsetzbar, da das Platzangebot bereits heute in einigen Stadtbezirken zu gering ist.
Für die Praxis problematisch ist, dass derzeit die Entscheidungen über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung vielfach erst nach Ablauf des Anmeldeverfahrens getroffen werden. Eine praktikable Durchführung der Aufnahmeverfahren an den Schulen unter
Einbeziehung der Schüler/innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung setzt
aber voraus, dass die Entscheidungen dann bereits getroffen sind. Diesem Erfordernis
muss durch entsprechende Verfahrensregelungen und Terminfestlegungen in der AO-SF
Rechnung getragen werden.
18
Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 SchulG müsste entsprechend angepasst
werden, insbesondere was die Bandbreiten zur Klassenbildung angeht (analog den Erfordernissen zum 8. Schulrechtsänderungsgesetz).
§ 132 Abs. 1
Kreise und kreisangehörige Gemeinden als Schulträger können im Gebiet eines Kreises
mit Genehmigung der Oberen Schulaufsichtsbehörde vereinbaren, ihre Förderschulen mit
dem Förderschwerpunkt Lernen, mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale
Entwicklung und mit dem Förderschwerpunkt Sprache auch dann aufzulösen, wenn sie
die in der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen bestimmten Schülerzahlen erreichen. Dabei muss gewährleistet sein, dass allein die allgemeine Schule Ort
der sonderpädagogischen Förderung ist; § 20 Absätze 2 und 4 und § 78 Abs. 4 sind in
diesem Fall nicht anwendbar. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für kreisfreie Städte
als Schulträger. Die Rechtstellung der Schulen in freier Trägerschaft bleibt unberührt.
Auch an dieser Vorschrift wird deutlich, dass das Land, das seinerseits der Empfehlung der
von ihm beauftragten Gutachter Klemm und Preuß-Lausitz, alle Förderschulen im Bereich
der Lern- und Entwicklungsstörungen zu schließen, nicht folgt, und die Verantwortung
auch insoweit auf die Kommunen verschiebt, um folgenden Diskussionen und Finanzierungsverpflichtungen aus dem Weg zu gehen.
Ferner unterschätzt diese Vorschrift die Schwierigkeiten der Abstimmung der kreisangehörigen Gemeinden im kreisangehörigen Raum. Eine einheitliche Einigung aller Schulträger
auf Kreisebene zur Schließung aller Förderschulen mit den genannten Förderschwerpunkten dürfte aufgrund der verschiedenen Schul- und Kostenträger kaum zu erreichen sein.
§ 132 Abs. 3
Für Schüler/innen mit einem besonders ausgeprägten, umfassenden Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
können öffentliche und freie Schulträger in den Fällen
1. des Absatzes 1 oder
2. des Absatzes 2 bei Auflösung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde einen schulischen Lernort einrichten. Dieser kann als Teil einer allgemeinen Schule oder als Förderschule geführt werden.
Darin werden Schüler/innen befristet mit dem Ziel unterrichtet und erzogen, sie auf die
baldige Rückkehr in den Unterricht ihrer allgemeinen Schule vorzubereiten. Die Kinder
und Jugendlichen bleiben Schüler/innen der allgemeinen Schule.
Die Koppelung der Einrichtung von schulischen Lernorten mit der Auflösung von Förderschulen wird in Frage gestellt. Auch jenseits der Auflösung von Förderschulen kann es der
Errichtung eines regional ausgerichteten Unterstützungssystems für die Allgemeinschulen
bedürfen, die sich auf den Weg zur Inklusion machen. Beispielsweise hat die Stadt Köln in
ihrem Inklusionsplan für Kölner Schulen ein Umsetzungsmodell entwickelt: In jedem
Stadtbezirk soll ein regionales Unterstützungszentrum eingerichtet werden, in dem die
Unterstützungsleistungen für allgemeine Schulen mit gemeinsamem Lernen organisiert
19
werden. Hier sollen all die kommunalen Dienste in gebündelter Weise zugänglich und
nutzbar gemacht werden, die wesentlich für die Unterstützung des Inklusionsprozesses
sind. Hierbei sollen alle vorhandenen Ressourcen und Netzwerke genutzt werden. Überlegt
werden könnte, die vorhandenen Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung
geordnet in Unterstützungszentren zu überführen.
Auch im kreisangehörigen Raum löst die Regelung aufgrund der unterschiedlichen Schulträgerzuständigkeiten Probleme aus. So ergibt sich beispielsweise für das Gebiet des Kreises Mettmann, der durch seine vorbildhafte kreisweite Förderschulentwicklungsplanung als
Vorreiter anzusehen ist, eine Frage, die für die zukünftige Schullandschaft von zentraler
Bedeutung ist: Voraussetzung für die Errichtung eines schulischen Lernorts ist ein Beschluss zur Auflösung aller Förderschulen eines Schulträgers mit dem Förderschwerpunkt
Emotionale und soziale Entwicklung. Im Kreis Mettmann ist es durchaus vorstellbar, eine
der beiden Förderschulen für Emotionale und soziale Entwicklung in einen schulischen
Lernort umzuwandeln. Die Forderung, dass alle Förderschulen ES geschlossen werden
müssen, um schulische Lernorte zu errichten, ist eine kaum überwindbare Hürde. Der
Schulträger würde hierdurch verpflichtet, ggf. gut funktionierende Strukturen zu zerschlagen, ohne den Erfolg eines schulischen Lernortes bereits einschätzen zu können. Selbst
wenn angenommen wird, dass die Formulierung eine sukzessive Schließung der Förderschulen zulässt, müssen sich Schulträger auf ein Experiment einlassen, dessen Folgen
noch nicht in Gänze absehbar sind.
Zudem sollte die vorherige Schließung der Förderschule nicht Voraussetzung für die Errichtung eines schulischen Lernortes sein. Vielmehr sollte das Schulgesetz auch die Möglichkeit
eröffnen, eine Förderschule bzw. ein Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung in ein Unterstützungszentrum umzuwandeln. Mit einer solchen Formulierung würde
klargestellt, dass die Schulleitung und das Kollegium der ehemaligen Förderschule in dem
schulischen Lernort verbleiben können. Zudem könnte so ein sanfter Übergang von der
(auslaufenden) Förderschule zu einem schulischen Lernort gestaltet werden.
Ferner sollten im Hinblick auf die temporäre Beschulung einzelner Kinder in einer Übergangsphase über den Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung hinaus weitere Förderschwerpunkte zugelassen werden.
2. Art. 2 – Übergangsvorschriften
Abs. 1
Die Regelungen in § 19 Absatz 5 Satz 3 des Schulgesetzes NRW finden nach Maßgabe
dieses Gesetzes erstmals Anwendung
1. zum Schuljahr 2014/2015 für Schüler/innen, bei denen erstmals ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung festgestellt wurde oder die eine Förderschule besuchen
und in die Klasse 5 einer weiterführenden Schule oder die Eingangsklasse einer gymnasialen Oberstufe wechseln wollen; zum Schuljahr 2015/2016 und zu den darauf folgenden Schuljahren gelten diese Bestimmungen auch für Schüler/innen der jeweils nächsthöheren Klasse,
2. zum Schuljahr 2016/2017 für Schüler/innen der Eingangsklasse eines Berufskollegs;
20
zum Schuljahr 2017/2018 und den darauf folgenden Schuljahren gilt dies auch für die
Schüler/innen der jeweils nächsthöheren Klasse.
Aus Gründen der Gleichbehandlung erscheint es problematisch, dass zunächst nur die Kinder der genannten Eingangsklassen berücksichtigt werden. Hier wird der Bedarf auch für
eine Vielzahl von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in höheren Jahrgängen gesehen, für die ein Wechsel von der Förderschule in eine allgemeine Schule sinnvoll erscheint. Für diese Gruppe von Schüler/innen wäre eine Übergangslösung wünschenswert.
Abs. 2
Der Schulversuch „Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung gemäß § 20 Abs. 5 Schulgesetz NRW“ endet mit Ablauf des Schuljahres
2013/2014. Die daran beteiligten Förderschulen werden als Förderschulen fortgeführt.
In Kompetenzzentren für die sonderpädagogische Förderung (KSF) ist in den letzten Jahren beachtliche Arbeit geleistet worden, die durch die vorgesehene Abschaffung gering
geschätzt wird. Mit der Schließung der Kompetenzzentren und einer damit einhergehenden
Unmöglichkeit ihrer Weiterentwicklung beraubt das Bestreben zu einem inklusiveren
Schulsystem sich wichtiger Orte bzw. Instanzen nach wie vor dringend benötigter sonderpädagogischer Kompetenz in den genannten Bereichen. Insbesondere auch aus Sicht der
unteren Schulaufsicht konnten im Laufe des Aufbau- und Entwicklungsprozesses folgende
positive Effekte erreicht werden:
Niederschwelliger Zugang zu sonderpädagogischer Förderung.
Kooperation der Förderschulen mit allen allgemein bildenden Schulen.
Gute Vernetzung der Pädagogen und daraus resultierend ein gemeinsames Beratungskonzept, das sich an den Bedarfen des einzelnen Kindes orientiert.
Flexible Möglichkeiten, den Schulwunsch der Eltern zu realisieren. Clearing- und Diagnostikphasen sind im Konsensfall sowohl in Regelschule als auch an Förderschule
ohne AO-SF möglich.
In allen Regelschulen stehen Sonderpädagogen der KSF als Berater zur Verfügung.
Damit nehmen die KSF eine maßgebliche Rolle auf dem Weg zur inklusiven Schullandschaft wahr: Die Akzeptanz der KSF-Lehrer in der Regelschule sollte genutzt werden, um
nach und nach mehr Schulen zum Einstieg in die Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu motivieren. Die flexible Verweildauer der Schüler/innen an der
Förderschule ermöglicht größere Spielräume bei der Realisierung der Elternwünsche. Die
Förderkonferenzen für die einzelnen Schüler/innen am Ende der Grundschulzeit in den KSF
leisten eine wichtige Vorarbeit für die Inklusionsrunde im Schulamt, die die Versorgung der
Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf in der SEK I koordiniert.
Mit einer Abschaffung der KSF ist ein Verlust der Qualität der jetzigen Beratungskultur
verbunden. Für die Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf entfällt die bis-
21
her mögliche flexible, auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte und unbürokratische Möglichkeit der sonderpädagogischen Förderung an den Förderorten allgemeine Schule oder
Förderschule. Letztendlich kann mit dem Verlust dieser Qualitäten ggf. sogar ein Ansteigen
der Schülerschaft an den Förderschulen verbunden sein. Der des Weiteren mit der Auflösung der Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung einhergehende Verzicht
auf den Arbeitsbereich „Prävention“ stellt im Sinne einer angestrebten inklusiven Schullandschaft einen Rückschritt dar.
Es sollten jedenfalls längere Übergangsfristen für den Erhalt der Kompetenzzentren gelten,
um die grundlegenden Kooperationen zu verfestigen und in der weiteren Umsetzung der
inklusiven Beschulung an die Regelsysteme zu verlagern. Im Sinne eines Übergangsmanagements hin zur inklusiven Schule in dafür vorzuhaltenden Zeiträumen könnten die Kompetenzzentren für die sonderpädagogische Förderung mit ihren bis jetzt gewachsenen
Netzwerken begleitend und unterstützend wirken; möglicherweise auch als Übergangsorte
sonderpädagogischer Förderung. Vielleicht ist es auch möglich einen Transformationsprozess zu den nach § 132 Abs. 3 SchulG-Entwurf vorgesehenen schulischen Lernorten zu
organisieren.
3. Art. 4 – Inkrafttreten, Berichtspflicht
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die Umsetzung der VNBehindertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006 durch Art. 1 und 2 wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das Ministerium berichtet namens der Landesregierung dem Landtag darüber bis zum 31. Dezember 2018, der Bericht erstreckt sich auch
auf die Veränderung des regionalen Schulangebots (allgemeine Schulen als Orte der sonderpädagogischen Förderung, Schwerpunktschulen, Förderschulen), die Inanspruchnahme
der Öffnungsklausel gem. § 132 Abs. 1-3 SchulG NRW und auf die Ausnahmeentscheidungen gem. § 20 Abs. 4 und 5 SchulG NRW. Die Kommunalen Spitzenverbände sind an
der Erstellung des Berichts zu beteiligen.
Die im Gesetzentwurf am Ende beigefügte „Evaluierungsklausel“, die eine Berichtspflicht
des Landes unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände vorsieht, ist nicht geeignet, die Verletzung des Grundsatzes der Konnexität zu kompensieren. Sie vermag den berechtigten Interessen der Städte und Gemeinden, für die Umsetzung der Inklusion im
Schulbereich mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet zu werden, nicht zu entsprechen. Zunächst ist festzustellen, dass in der Formulierung des Gesetzentwurfs zur „Berichtspflicht“ von einer Betrachtung der Kosten überhaupt nicht die Rede ist. Dieser Aspekt
findet sich erst in der Begründung. Selbst in der Begründung bleibt aber völlig offen, ob
überhaupt selbst bei erheblichen festgestellten Mehrkosten eine Kostenbeteiligung oder erstattung durch das Land vorgesehen ist und ob eine solche rückwirkend oder erst im
Anschluss an die besonders investitionsintensiven ersten Jahre der Umsetzung der schulischen Inklusion nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz angedacht ist. Die notwendig
entstehende erhebliche Unsicherheit der Kommunen über das „ob“ und die Höhe einer
eventuellen Kostenbeteiligung des Landes nach der Evaluation würde sich gerade in der
erheblich investitionsintensiven Anfangsphase der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich unweigerlich negativ auf das Engagement der Schulträger auswirken. Auch sehr inklusionswillige und engagierte Räte und Kreistage brauchen eine klare Entscheidungs-
22
grundlage. Bemerkenswert ist auch, dass lediglich eine Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände vorgesehen ist. Eine ernstgemeinte Evaluation gerade auch unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen auf die Schulträger kann allerdings nur im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden geschehen.
Die im Gesetzentwurf nun enthaltene Evaluierungsklausel (Art. 4 des Entwurfs) ist somit
völlig unzureichend.
D. Zum Entwurf für eine Rechtsverordnung über die Größe der Förderschulen und
der Schulen für Kranke
I. Regelung muss im Schulgesetz erfolgen
Nach der verfassungsrechtlich allgemein anerkannten Wesentlichkeitstheorie auf der
Grundlage des Parlamentsvorbehalts ist es in unserem parlamentarisch-repräsentativdemokratisch verfassten Staatsaufbau erforderlich, dass die wesentlichen, insbesondere
die grundrechtsrelevanten Entscheidungen vom Parlament selbst getroffen werden. Sie
können nicht an die Exekutive zur untergesetzlichen Normgebung verwiesen werden. Dies
setzt insbesondere auch der Schaffung von Verordnungsermächtigungen Grenzen. Über
die Festlegung von Mindestgrößen für Schulen können ganz erhebliche Gestaltungswirkungen in der Schullandschaft herbeigeführt werden. Wie wir bereits mit Schreiben vom
15.05.2013 an die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen ausgeführt haben, bestünde mit
der nach unserem Kenntnisstand geplanten untergesetzlichen Regelung die erhebliche Gefahr, dass das politisch gewollte (vgl. den Landtagsbeschluss vom 01.12.2010) und mit
einem etwaigen Beschluss des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes durch den Landtag auch
im Gesetz verankerte Elternwahlrecht in der Praxis dadurch leerlaufen könnte, dass in akzeptabler Entfernung eine Beschulung an einer Förderschule gar nicht mehr möglich wäre.
Eine solche faktisch sehr weitreichend steuernde Regelung von erheblicher Tragweite für
die Schulwahlmöglichkeiten für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
muss daher aus verfassungsrechtlichen Gründen vom Parlament selbst getroffen werden.
Für die anderen Schulformen werden diese Festlegungen auch direkt im parlamentarisch
beschlossenen Schulgesetz (vgl. § 82) geregelt. Warum ausgerechnet nur für die Förderschulen eine solche Regelung nicht so wichtig sein und daher eine Rechtsverordnung sogar
ohne Zustimmung des Ausschusses ausreichen sollte, ist nicht nachvollziehbar. Die derzeitige nur aus historischen Gründen zu erklärende Verordnungsermächtigung in § 82 Abs. 10
SchulG ist daher nach unserer Auffassung als verfassungswidrig zu qualifizieren. Im Zuge
der Überarbeitung des Schulgesetzes durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz sollte der
Landtag daher auch an dieser Stelle die dringend nötige Anpassung vornehmen und auch
für die Förderschulen seiner parlamentarischen Verpflichtung nach der Wesentlichkeitstheorie nachkommen und die Mindestgröße selbst bestimmen. Wir schlagen daher vor, den
Regelungsinhalt des § 1 der geplanten Verordnung vollständig in § 82 Abs. 10 des Schulgesetzes zu übernehmen. Die Übergangsvorschriften des § 2 der Verordnung können in
Art. 2 des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes eingearbeitet werden.
23
II. Gewährleistung von Flexibilität für die Schulentwicklungsplanung
Es ist der erklärte politische Wille der Landesregierung, dass einerseits in Zukunft die allgemeine Schule der Regelförderort für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sein
soll, aber andererseits die Förderschulen als solche nicht landesseitig abgeschafft, sondern
das Elternwahlrecht erhalten bleiben soll (vgl. nochmals den Landtagsbeschluss vom
01.12.2010). Klar ist, dass jede Schule in NRW eine gewisse Mindestgröße braucht, um
ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Damit dennoch das Elternwahlrecht erhalten bleibt
und tatsächlich eine freie Entscheidung über den Förderort der Kinder und Jugendlichen
mit Behinderung möglich ist, bedarf es aber klug gewählter bzw. definierter Mindestgrößen, eines tauglichen Instrumentariums um gebietskörperschaftenübergreifende Verbundlösungen zu ermöglichen und Öffnungsklauseln für die wenigen Fälle, in denen, trotz erheblicher Anstrengungen der Schulträger, eine Förderschule nicht in zumutbarer Entfernung erreichbar ist.
III. Sinnvolle Übergangsregelungen
Die geplanten Veränderungen im 9. Schulrechtsänderungsgesetz und in der Rechtsverordnung über die Größe der Förderschulen und der Schulen für Kranke bringen einen erheblichen Anpassungsbedarf für die kommunalen Schullandschaften mit sich. Die daraus folgenden notwendigen Umstrukturierungsprozesse erfordern einen großen Abstimmungsaufwand mit allen am Schulleben in einer Kommune Beteiligten und mit den Nachbarstädten/-gemeinden, den Kreisen und ggf. auch zwischen mehreren Kreisen und kreisfreien
Städten. Schulfachlich und schulpolitisch gut durchdachte und tragfähige Lösungen benötigen den erforderlichen Vorbereitungszeitraum. Auch wenn schon heute viele Schulträger
von sich aus über die künftige Beschulung ihrer Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen in den Allgemeinen Schulen und in Förderschulen nachdenken und ggf. mit anderen
nach passenden Lösungen suchen und zu erwarten ist, dass keine Kommune die notwendigen Prozesse nach In-Kraft-Treten einer neuen Regelung zur Mindestgröße der Förderschulen und der Schulen für Kranke hinauszögern wird, erfordern die dann stattfinden Planungs- und Abstimmungsverfahren passend bemessene Übergangszeiten. Dies gilt umso
mehr, als im Jahr 2014 in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen durchgeführt werden
und es einer guten demokratischen Tradition entspricht, die politische Willensäußerung des
Volkes nicht durch „Schaffung vollendeter Tatsachen“ in Folge eines unnötigen Zeitdrucks
zu präjudizieren.
Die jüngste sehr deutliche Kritik des Landesrechnungshofes an klaren Vollzugsdefiziten der
Landesverwaltung darf nicht zu einem unangemessenen und unzweckmäßigen Zeitdruck
auf die kommunalen Schulträger führen. Die Verantwortung für die seit vielen Jahren
mangelnde Umsetzung der bisherigen Regelungen liegt bei der Schulaufsicht des Landes.
Durch das sehr lange bewusste Akzeptieren des Status-Quo der Förderschullandschaft ist
ein Vertrauensschutz für Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und Schulträger entstanden,
der nicht durch übereilte Gegensteuerungen verletzt werden darf. Hier erscheint ein Übergangszeitraum von mindestens drei Jahren erforderlich und geeignet, um einerseits geordnete Schulentwicklungsplanung und -umsetzung zu ermöglichen und andererseits das
24
Greifen der neuen Regelungen nicht zu lange hinauszuschieben. Erst danach dürfen neue
Mindestvorgaben verbindlich werden.
Ein solcher Übergangszeitraum wird neben den schulorganisatorischen Planungen zudem
auch dringend erforderlich sein, um die pädagogischen Konzepte der allgemeinen Schulen
an die inklusive Beschulung nachhaltig anzupassen und dort einen Wechsel zu einem individuell schülerorientierten Lehrkonzept zu sichern.
E. Abschließendes Fazit
Eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzentwurfs, die erforderliche Einbeziehung der
Qualitäts- und Ressourcenfragen, die gesetzliche Regelung der Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke und die Anerkennung der grundsätzlichen Konnexitätsrelevanz der Umsetzung des Art. 24 der VN-BRK durch das nordrhein-westfälische
Schulgesetz halten wir für unumgänglich.
Für den Fall einer Weiterverfolgung des jetzt eingeschlagenen Weges der Umsetzung ist
ein Scheitern der schulischen Inklusion sowie ein Vertrauensverlust auf Seiten der Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen, weiteren beteiligten Berufsgruppen und der Kommunen zu
befürchten.
Köln und Düsseldorf am 21. Mai 2013
Dr. Stephan Articus
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Städtetages Nordrhein-Westfalen
Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer
des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen